Das erste Treffen mit dem Revierförster von St. Goar, Hubertus Jacoby, war so interessant und ergiebig, dass wir von den mir vorgenommenen 11 Fragen nur 2 besprechen konnten. (Siehe Blog vom 21.2.2016).
Wir haben uns also wieder im “Landgasthaus Rebstock” in St. Goar-Biebernheim verabredet, um den Dialog fortzusetzen, und es war wieder ein interessanter, spannender und lehrreicher Abend, viel länger als geplant und mein Fragebogen weist nach dem 4-stündigen Treffen immer noch zahlreiche offenen Fragen auf.
Wir begannen uns zunächst über den Waldaufbau im Forstgebiet von Herrn Jacoby zu
unterhalten. Um aus einer gerodeten Fläche wieder einen Wald entstehen zu lassen, bedarf es eines Zeitraums von bis zu 250 Jahren! Zunächst müssten z.B. bei der Baumart Eiche auf einer Fläche von 1 ha 30.000 Eicheln gesät oder 10000 kleine einjährige Pflänzchen gepflanzt werden, die dann ca. 250 Jahre wachsen müssen, um “hiebsreif” zu sein, also gefällt werden könnten.
Der Zyklus eines frisch angepflanzten Waldes teilt sich in
Kultur
und
Jungbestand.
Der Förster Hubertus Jacoby in seinem Revier
Die heranwachsenden Bäume müssen durchforstet werden, um die “Z-Bäume” zu begünstigen. Nach 40 Jahren bis 50 Jahren werden die ersten Bäume gefällt, um das Wachstum der “Z-Bäume” optimal zu gewährleisten.. Die dichte Bepflanzung des “Jungwaldes” führt auch dazu, dass diese Bäume nicht so viele Äste haben und somit gerade wachsen und einen glatten Stamm haben. Alle ca. 15 Metern steht ein ”Z-Baum”, der von sogenannten “Bedrängern” befreit wird, damit er ungestört wachsen kann. Der “Z-Baum” muss während seines Wachstums kontinuierlich gepflegt werden, beispielsweise muss die Rinde unbeschadet bleiben, “Bedränger “ dürfen den Baum nicht beschädigen. So entsteht im Laufe von 250 Jahren ein Wald mit ca. 150 bis 200 Bäumen pro Hektar, die einen optimalen Lebensraum während ihres Wachstums bekommen haben. Eine Eiche, die unter diesen Bedingungen gewachsen ist, kann nach 250 Jahren bis 300 Jahren einen Wert von ca. 4.000.€ haben, was ca. 1.300.€/Festmeter entspricht. Eine Eiche, die unter “normalen” Bedingungen in gleicher Zeit gewachsen ist, hat lediglich einen Wert von 300 € bis 400.€ pro Festmeter.
Der Waldes im Forstrevier St. Goar teilt sich in 70% Laubwald und 30 % Nadelwald auf, die Buchen sind bis zu 250 Jahre, die Tannen bis zu 200 Jahre alt. Linden werden weitgehend nur als “Nebenbäume” gehalten, um in Eichenkulturen diese möglichst astfrei wachsen zu lassen.
Die bisher weitverbreitete Fichte wird seit geraumer Zeit durch die nordamerikanischeDouglasie ersetzt. Die Fichte ist in den 50iger Jahren als schnellwachsender und damit renditestarker Baum gepflanzt wurden. Dabei wurde allerdings nicht bedacht, dass eine Fichte jährlich eine Niederschlagsmenge von 1.600. Liter bis 1.800 Liter/qm benötigt, um gesund zu bleiben. Der Hunsrück hat allerdings nur eine durchschnittliche Regenmenge von ca. 300 Litern pro Quadratmeter. Zudem ist die Fichte ein Flachwurzler, der auch noch stumgefährdet ist.
Die Douglasie hingegen kommt mit deutlich geringeren Regenmengen aus und hat ein tieferesWurzelwerk, ein sogenanntes “Herzwurzelwerk”, wodurch die Douglasie auch an tieferes Grundwasser zu ihrer Versorgung kommt und wesentlich ungefährdeter gegen Stürme ist.
Das Thema “Waldsterben”, das vor wenigen Jahren noch für Schlagzeilen gesorgt hat, ist mittlerweile in den Hintergrund getreten. Der Grund hierfür ist allerdings nicht der Umstand, dass der Turnaround geschafft wurde und der Wald wieder gesund ist, sondern Presse und Politik widmet sich anderen Themen zu, die ihnen wichtiger erscheinen. Das Waldsterben hat leider keinen Nachrichtenwert mehr.
Die Fichten, die vom Waldsterben besonders betroffen sind, hat der Mensch aus Profitgier in Regionen gepflanzt, in die diese Baumart nicht hingehört. Die Fichte wurde auch als “Brotbaum” bezeichnet, denn sie ist bereits nach 70 Jahren bis 80 Jahren”hiebsreif”, zur Erinnerung, eine Eiche benötigt ca. 250 Jahre bis 300 Jahre bis sie “hiebsreif” ist. Um 70 Jahre bis 80 Jahre alt zu werden, benötigt die Fichte allerdings ausreichende Mengen an Wasser, was, wie geschrieben, im Hunsrück nicht der Fall ist. Das fehlende Wasser ist also der Hauptgrund, weshalb die Fichten so früh sterben.
Der in der Presse gerne als der “Waldkiller” bezeichnete Borkenkäfer hingegen tut nur seine, ihm von der Natur auferlegten Pflicht, kranke Bäume zu beseitigen. Jede Fichte verfügt über das Cambium, das es dem Borkenkäfer bei ausreichender Wasserversorgung des Baumes unmöglich macht, den Baum zu beschädigen. Mit ”Cambium” bezeichnet man die Schicht zwischen Holz und Rinde. Im Cambium laufen alle Wasserleitungen des Baumes von der Wurzel zur Krone. Bohrt sich der Borkenkäfer also durch die Rinde in den gesunden Baum hinein, wird er im Cambium ertrinken, denn durch die Wasserleitungen kann der Käfer nicht dringen. Bei kranken Fichten, die unter dem angesprochenen Wassermangel leiden, besteht das Problem nicht und der Borkenkäfer kann die Fichte so stark schädigen, dass sie zugrunde geht.
Wenn ein Sommer deutlich zu trocken ist, haben die Bäume einen Mechanismus, mit dem sie diese Perioden überstehen können: sie werfen Blätter, bzw. Nadeln ab und können so instinktiv die Anzahl der “Verbraucher” reduzieren. Diese Assimilationsorgane sind ein wichtiger Baustein in der Überlebensstrategie der Bäume!.
Einen positiven Effekt hat das Waldsterben aber doch mit sich gebracht: Der Mensch hat sich besonnen die naturgemäße Waldwirtschaft einzuführen. Die Anpflanzung von Fichten wird beispielsweise nicht mehr im Hunsrück gefördert. Stattdessen hat man sich auf die naturgemäße Waldbewirtschaftung besonnen. Man muss den Wald beobachten und erkennen, was die Natur will und was sie den Bäumen bietet. Diese Sukzession ist abhängig von den Böden, der Höhenlage und dem Klima. Das kennt man ja von Urlauben in den Bergen, wo auf den Höhen keine Laubbäume mehr wachsen können, stattdessen Kiefern und Lärchen. Überlasst man einen Kahlschlag der natürlichen Sukzession und dieser Philosophie entsprechend, dann w entsprechend, dann wachen zunächst Gräser und Kräuter, danach Sträucher und anschließend Pionierbaumarten wie bei uns die Birke, Weide, sowie die Kiefer und in Feuchtgebieten die Roterle. Nach vielen Jahren hat man dann einen Wald, der Region entsprechend, bestehen aus den heimischen Baumarten Eiche, Buche und Hainbuche. Soweit zum Wald und dessen Pflege im Hunsrück.
Natürlich verfügen die Wälder zwischen Bingen und Koblenz auch über zahlreiche
Wildtierarten.
Das Rotwild (Hirsche) teilt sich auf in
Hirsche und Alttiere.
Die davorliegende Generation sind die sogenannten Schmaltiere und Schmalspießer, die Kälber sind die jüngsten im Rudel.
Der Soonwald, der Hochwald und der IdarWald waren einst die Kerngebiete des Rotwildes. Durch Naturkalamitäten wurde der Wald vernichtet, was aber in erster Linie durch den Menschen (hauptsächlich unnatürliche monotone Fichtenwälder und somit Sturmschäden) verursacht wurde. Das Rotwild sucht sich neue Lebensräume, was nicht nur das Jägerherz höher schlagen lässt, aber auch den Förster wegen den größer gewordenen Verbiß- Schäl- und Schlagschäden besorgt macht. Die Rudel benötigen große Wälder, um in Ruhe zu leben, denn ihr Tagesablauf ist klar strukturiert: Fressen, Ruhe, Fressen, Ruhe und so weiter. Die als Ruhezonen benötigten Waldflächen sind mittlerweile zu klein, so dass das Wild durch Spaziergänger und Wanderer oft aufgescheucht wird. Dadurch verlässt das Rotwild den Wald seltener und sucht sich dort neue Nahrung. Fichte und Buche wird “geschält”, das heißt, die Rinde dient den Tieren als Nahrung, was wiederum zu stark geschädigten Bäumen führt, die daran auch eingehen können oder in ihrer Qualität stark beeinträchtigt werden.
Heimisches Rehwild gliedert sich in
Rehbock (männlich) Ricke (weiblich)
Schmalreh
Jährlingsbock
Kitze (beiderlei Geschlechtes)
Muffelwild auch Wildschaf genannt
Der Mensch hat das aus Sardinien stammende Schaf vor ca. 60 Jahren in unserer Region ausgesiedelt, um es zu jagen. Die Trophäen der erlegten Tiere “zieren” so manches Jagdzimmer von Jägern. Das Muffelwird verursacht sehr große Waldschäden, denn sie “schälen” die Wurzelanläufe der Bäume,
Das Muffelwild-Rudel gliedert sich in
Widder (männlich) Schaf (weiblich)
Schmalschaf
Lämmer
Diese Tiere sind sehr scheu und sind nur selten zu sehen. Hier hat wiederum der Mensch die Natur negativ beeinträchtigt.
Raubwild (alte Bezeichnung)
Der Fuchs wird gerne gejagt. Im Forstrevier von Hubertus Jacoby herrscht seit 10 Jahren ein Jagdverbot auf den Fuchs . Er ist ein enger Verbündeter des Försters, beispielsweise bei der natürlichen Reduzierung von schadhaften Mäusen, die große Schäden im Wald anrichten,in dem sie beispielsweise die Wurzeln und Rinde von jungen Bäumen annagen und so die wertvollen Pflanzen zum Sterben bringen. Kollateralschäden wie beispielsweise durch Mäusegift, dem auch andere Tiere zum Opfer fallen, gibt es dadurch nicht!
Außerdem gibt es noch
den Dachs
den Marder
den Iltis
das Wiesel und
die Wildkatze. Sie kommt ebenfalls in den Wäldern um St. Goar häufig vor.
Herr Jacoby hat eine der sehr scheuen Wildkatzen eines Tages auf seinem Hochsitz entdeckt, die dort gerade geworfen hatte. Er hing daraufhin ein “Betreten Verboten”Schild an die Leiter, so daß die Wildkatze stressfrei ihren Wurf großziehen konnte.
Schwarzwild
Die Wildschweine sind, wie kaum ein anderes Wild, von der Nahrungsmenge abhängig. Je mehr Futter vorhanden ist, desto mehr Nachwuchs wird geboren, je mehr Nachwuchs kommt, je mehr Hunger verbreitet sich. So reguliert die Natur die Anzahl des Schwarzwildes. Eine Wildsau wirft in nahrungsreichen Jahren bis zu zwei Mal im Jahr, die Größe des Wurfes liegt zwischen 5 und 15 Frischlingen. Wildschweine können sehr große Schäden in der Landwirtschaft und im Weinbau verursachen. Im Wald sind sie eher nützlich. Nach dem Verspeisen von großen Mengen Eicheln oder Bucheggern benötigt das Schwarzwild Eiweiß, was es in Form von Käfern, Larven und Würmern sucht.. Diese findet es unter der Humusdecke, die sie mittels ihrem Wurf (Schnauze) öffnet. Die auf diese Art aufgewühlte Flächen hat jeder bestimmt schon mal gesehen. Aber die Natur macht grundsätzlich nichts, was nicht auch für andere Lebewesen einen Vorteil hat. Ist die Rohhumusdecke im Wald umgepflügt, können Samen von Pflanzen und Bäumen leichter in den darunterliegenden Humus gelangen, was das Aufgehen des Samens deutlich begünstgt.
Ein von Wildschweinen umgepflügtes Feld
Wildschweine suchen ihr benötigtes Eiweiß nicht nur in Wäldern und Wiesen, sondern auch in Weinbergen, wo sie mit Vorliebe die roten Trauben fressen.
Im Gegensatz zu den Eigentümern des Waldes und der Wiesen, erhalten Winzer vom Jagdpächter keine Entschädigung, da Reben “Sonderkulturen” und somit nicht entschädigungsfähig sind.
Der Förster Jacoby veranstaltet seit vielen Jahren im Januar ein “Aussöhnungs”- Treffen zwischen Jägern und Winzern. Serviert wird ein in dem alten Brotbackofen von Morshausen angerichtetes Essen , das “Backes Wildschwein”, das am Mittelrhein “Dippelkulles” und in IdarOberstein “Schales” heißt. Ein so weit verbreitetes Mahl muß also schmecken, hier deshalb die Zutaten: Gemüse, Kartoffeln (gratiniert), Speck, Würstchen, Gewürze und natürlich Wildschweinbraten.
Das „Backes-Wildschein“
Greifvögel (früher Raubvögel) im Revier von Förster Jacoby sind :
Roter Milan( siedelt sich verstärkt an)
Habicht
Bussard
Waldeulen
Uhu(!)
Sperber
Falke
Schwarzstorch
Eine kleine Anekdote zum Schluss:
Herr Jacoby fand ein aus dem Nest gefallenes Sperber-Junges. Er nahm es mit nach Hause und “peppelte” es mit Hilfe einer Falknerin, die ihn beraten hat, wieder auf. Sie nannten den Sperber auf Vorschlag des jüngsten Enkel “Mogli”. Wenn heute beim Spaziergang ein Sperber am Himmel fliegt, fragt der Kleine den Opa “Ob das wohl Mogli ist?”
Die mittlerweile brachliegenden Weinberge in den Seitentälern des Rheins sind ein
hervorragender Lebensraum für Greifvögel, die auf natürliche Art und Weise für das
Gleichgewicht in der Natur sorgen.
Als wir begannen uns über die Probleme der Nutzung von Giften in Landwirtschaft und Weinbau zu unterhalten, guckte ich das erste Mal auf die Uhr. Mittlerweile waren wieder 4 ½ Stunden vergangen und wir vertagten deshalb dieses Thema auf das nächste Treffen, zu viel gibt es dazu zu sagen.
Ein Teil der Fotos wurde uns dankenswerterweise von S, Breitbach zur Verfügung gestellt
Um den neuesten Blog automatisch zu erhalten, bitte auf der Startseite die Emailadresse eintragen und den zugesandten Link bitte bestätigen.
Den Aufkleber „Mittelrheintal – Grand Canyon kann jeder“ ist über Ebay für 1,95€ zzgl. Porto (Suchbegriff „Aufkleber Mittelrheintal“ )zu beziehen oder einfach eine Mail an uns.







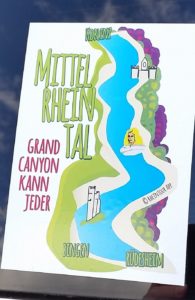
Auf dem Bild ist m.E. ein Baummarder und keine Wildkatze.
Das ist korrekt. Ich hatte kein Bild einer Wildkatze, wollte aber den Beitrag mit einem heimischen Waldtier anreichern. Mhm. Soll ich das Bild lieber rausnehmen oder des beschreiben?
Viele Grüße
Leider findet sich im Artikel nicht, wie der Förster zum Thema Windkraft steht, was im Hunsrück ja ein Problem ist.
ich habe einen Blogartikel über Windkraft geschrieben. Bitte guck mal und sag mir Deine Meinung.
Viele Grüße
http://rheintour.info/2016/04/09/windendenergie-laue-luft-oder-effizient
Die Förster sehen das Thema „Windkraft “ wie ich
Herzliche Grüße